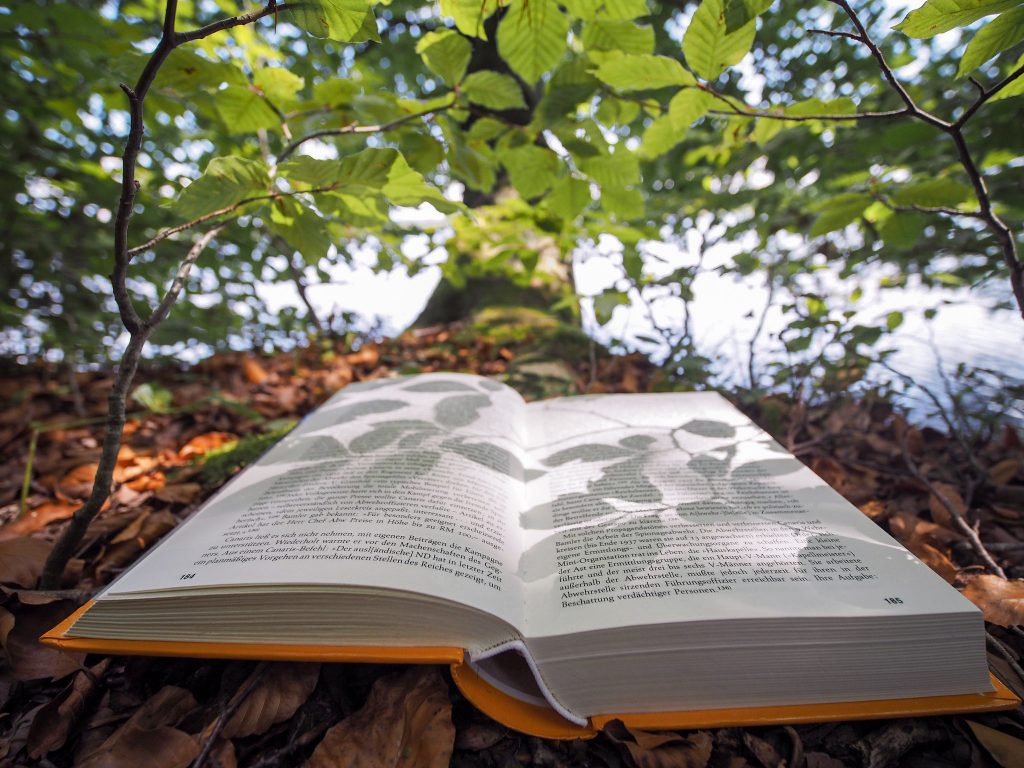Autobiografien sind meist fad, denn sie liefern einseitige Sicht, klingen womöglich selbstgerecht und verzichten auf historischen Kontext. Wen locken schon hunderte Seiten Alice Schwarzer über Alice Schwarzer.
Henry Nannen wollte keine Autobiografie schreiben, sagte er laut Hermann Schreibers Nannenbiografie,
weil es keine ehrlichen Memoiren gibt.
Ich hätte Nannens Autobiografie vielleicht trotzdem gelesen – nicht weil ich die Wahrheit erwarte, sondern weil es vielleicht unterhaltsam wäre.
Viel lieber lese ich nicht autorisierte Biografien anderer Autoren, die ihre Hauptfigur ohne falsche Rücksicht dekonstruieren. Sie dürfen gern aus den Autobiografien ihrer Titelhelden zitieren – und das dort Gesagte kritisch einordnen.
Manche *Auto*biografie las ich aber doch: Wenn der Autor eine interessante Erzählstimme hat. Dann rede ich eher von Memoiren als von Autobiografie – und ich betrachte das Werk eher als Fiktion. Die Fakten hole ich mir bei Bedarf aus einer echten, kritischen Biografie.
- Auf Amazon: beliebte Autobiografien, Biografien allgemein
Diese Autobiografien/Memoiren haben mir gefallen:
- James Salter: Verbrannte Tage (1997)
- Oskar Maria Graf: Gelächter von außen (1966)
- Tania Blixen: Jenseits von Afrika (1937)
- Barrack Obama: Ein amerikanischer Traum (1995, leicht fiktionalisiert)
- Lena Christ: Erinnerungen einer Überflüssigen (1912)
- Miles Davis: Miles, The Autobiography (1989, geghostet von Quincey Troupe)
- Frank Zappa: The Real Frank Zappa Book (1990)
- Gerald Brenan: South from Granada (1957)
- Paula Fox: In fremden Kleidern (2001)
Diese Memoiren gefielen mir weniger:
- Klaus Mann: Wendepunkt (1949)
- Auma Obama: Das Leben kommt immer dazwischen (2010)
- Anthony Burgess: Little Wilson and Big God (1986)
- D.J. Enright: Memoirs of a Mendicant Professor (1969)
- Viktor Mann: Wir waren fünf (1949)
- Gerhard Polt: Hundskrüppel (2004)
- Peter Moss: Distant Archipelagos (2004)
- Beryl Markham: Westwärts mit der Nacht (1942, vermutlich nicht allein geschrieben)
- Han Suyin: My House has two doors (1980)
- Konstantin Wecker: Das ganze schrecklich schöne Leben (2017, nur teils von Wecker)
- Salman Rushdie: Joseph Anton (2012)
Die autobiografischen Schriften von Georges Simenon habe ich auch schnell wieder weggelegt.
Diese Autobiografien interessieren mich noch:
- Manu Dibango: Three Kilos of Coffee (1994)
- Gerald Brenan: Face of Spain (1950) und evtl. A Life of One’s Own (1979)
- Hugh Johnson: A Life Uncorked (2006)
- Hildegard Knef: Der geschenkte Gaul
Autobiografisch grundierte Romane (etwa bei Hemingway, V.S. Naipaul, Paul Theroux, Paula Fox) sind hier nicht berücksichtigt, auch keine „Autofiktion“.